Die Berner Gymnasien machen beim digitalen Prüfen vorwärts. Weil es zeitgemäss, realitätsnäher und für alle gewinnbringend sei, sagen die Lehrpersonen für Deutsch Nicole Jakob und für Informatik und technischen Support Reto Zurbuchen vom Gymnasium Oberaargau.

2023 erfolgte am Gymnasium Oberaargau die Maturitätsprüfung im Fach Deutsch erstmals digital. «Ein bisschen hibbelig waren wir schon», gesteht Reto Zurbuchen. Um sicherzugehen, machte die Schule einen Testlauf. Fazit: «Die grösste Herausforderung bestand darin, genügend Steckdosen zu finden», sagt Reto Zur buchen augenzwinkernd.
Nicht mehr zeitgemäss
Im Kollegium herrscht Konsens: Wo immer sinnvoll, soll digital geprüft werden – unter dem Jahr und an der Maturitätsprüfung. Sinnvoll ist dies im Fach Deutsch. «Seit sechs Jahren verfassen die Schülerinnen und Schüler ihre Texte am Computer», sagt Nicole Jakob, «da ist es nicht zeitgemäss, den Maturaufsatz auf Papier schreiben zu lassen.» Informatiklehrer Reto Zurbuchen pflichtet bei: «Wer schreibt noch Programmcodes auf Papier?
Mit der Umstellung auf die digitale Umgebung bringen wir die Prüfungen näher an die Realität.» Was bedeutet das aus pädagogischer Sicht? Müssen die Prüfungen neu gedacht werden? «Je nach Fach», sagt Nicole Jakob. «Beim Aufsatz verändert sich die Aufgabenstellung nicht. Die Schülerinnen und Schüler müssen aber anders herangeführt werden, weil Texte am Computer bis zum Schluss überarbeitet werden können und die Rechtschreibprüfung eine trügerische Sicherheit bietet. Überraschenderweise hat sich nämlich die formalsprachliche Korrektheit kaum verbessert, Fehlerquellen haben sich lediglich verschoben. So häufen sich Kommafehler und fehlerhafte Gross- und Kleinschreibungen.» Im Fach Informatik hat sich die Prüfungsform stärker verändert. «Programmieren die Schülerinnen und Schüler am Computer, können sie die Codes sofort testen und modifizieren», erklärt Reto Zurbuchen, «daher stellen wir anspruchsvollere Aufgaben.»
Für alle ein Gewinn
Wichtig ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit digitalen Prüfungen vertraut machen. Dabei geht es primär um prozessuale Fragen. Was mache ich, wenn das Log-in nicht funktioniert, wie stelle ich sicher, dass die letzte Version gesichert wird, usw.? Einmal etabliert, ist das digitale Prüfen für alle ein Gewinn. Nicole Jakob: «Die Schülerinnen und Schüler erleben die Prüfungen realitätsnäher und als bessere Vorbereitung aufs Studium. Bei digitalen Texten gibt es keine unleserlichen Schriften, Korrekturen können im Kommentarmodus angebracht werden, und die Texte bleiben für Schreibberatungen verfügbar.» Sie seien auch prüfungsgerechter, ergänzt Reto Zurbuchen, «weil wir anonym korrigieren können. Bei analogen Prüfungen verrät die Handschrift die Schülerin bzw. den Schüler.» Für das Gymnasium Oberaargau gibt es also gute Gründe, digital zu prüfen. Diesen Sommer werden die Maturitätsprüfungen daher auch in den Fremdsprachen und im Fach Informatik digital durchgeführt.
Digitales Prüfen an Gymnasien – «Wir bringen die Prüfungen näher an die Realität»
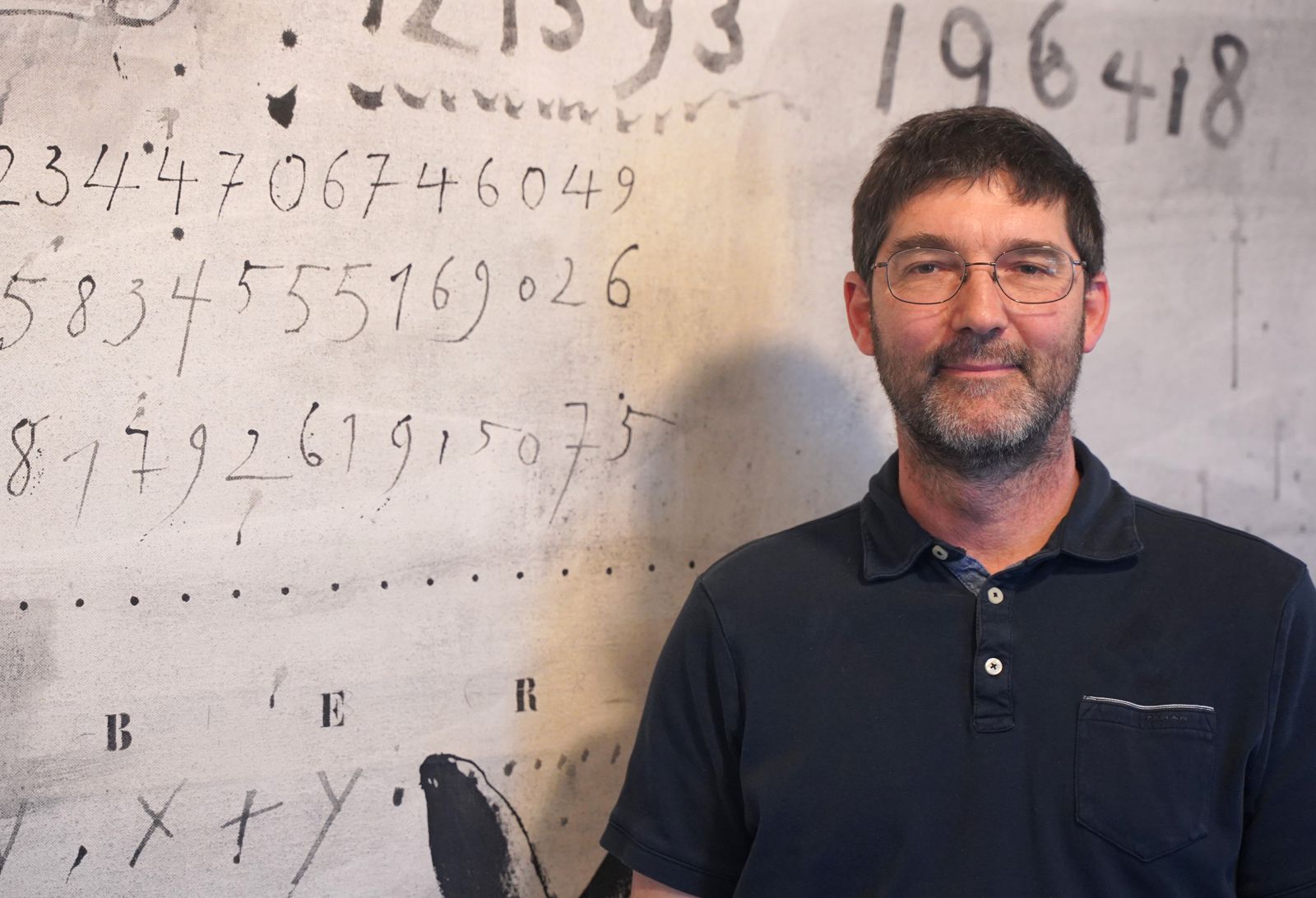
Interview mit Prof. Dr. Michele Weber
Maturitätsprüfungen erfolgen immer öfter digital. Was bringt das? Wo steht der Kanton Bern in diesem Prozess? Die Fragen gehen an Prof. Dr. Michele Weber. Er ist Präsident der Kantonalen Maturitätskommission (KMK) und Direktor des Laboratoriums für Hochenergiephysik an der Universität Bern.
Herr Weber, wie hält es die Universität Bern mit dem digitalen Prüfen?
Das ist von Fakultät zu Fakultät verschieden. In den Geistes- und Sozialwissenschaften sind bei Seminar arbeiten digitale Prüfungsformen etabliert, in den Naturwissenschaften wird eher noch analog geprüft.
Eignen sich nicht alle Disziplinen gleich für digitale Prüfungen?
Die Eignung variiert – je nach Fachbereich bzw. nach Grad, in dem digitale Tools im Arbeitsumfeld eingesetzt werden. In den Geisteswissenschaften ist die Sprache das zentrale Arbeitsinstrument. Schriftliche Arbeiten werden primär am Computer verfasst. Da ist es konsequent, am Computer zu prüfen. Anders in den Naturwissenschaften: Eine mathematische Gleichung stelle ich auch heute noch auf Papier auf. Zudem zählt bei einer Mathematikprüfung auch der Lösungsweg. Dieser lässt sich am Computer weniger gut darstellen.
Wo sehen Sie die Vorteile des digitalen Prüfens?
Es sollte überall dort eingesetzt werden, wo ein Mehrwert entsteht. Dieser ist gegeben, wenn wir Kompetenzen prüfen können, die aufgrund des technologischen Wandels heute verlangt werden. Ein Beispiel: Werden Grafiken nicht mehr auf Millimeterpapier gezeichnet, müssen wir die Kompetenz prüfen, diese am Computer zu erstellen.
Sind mit dem digitalen Prüfen spezifische Herausforderungen verbunden?
Ja. Wir müssen sicherstellen, dass keine unerlaubten Hilfsmittel verwendet werden. Im Alltag nutzen wir das Internet als Recherchetool. In der Prüfungssituation muss beachtet werden, dass Google, KI oder externe Fachleute die Antworten liefern könnten.
Wie verbreitet ist digitales Prüfen an den Berner Gymnasien?
Es ist wie an der Universität: In den Sprachen und in Fächern wie Geschichte, Wirtschaft oder Philosophie wird öfter digital geprüft als in Mathematik, Physik oder Chemie. Der Entscheid, ob ein Fach analog und digital geprüft wird, liegt – in Absprache mit der KMK – bei den Schulleitungen.
Welche Position vertritt die KMK?
Wir erwarten, dass digitale Prüfungen überall, wo dies sinnvoll ist, schnell eingeführt werden. Dies unter der Prämisse, dass analoge Prüfungen nicht eins zu eins ins Digitale übertragen werden. Inhalt, Methode und Bewertung müssen adaptiert werden – weil es nicht dasselbe ist, ob ein Aufsatz handschriftlich oder digital verfasst wird. Am Computer können Abschnitte verschoben und Korrekturprogramme genutzt werden. Daher müssen die Ansprüche an Inhalt, Aufbau, Ausdruck, Textlänge und Rechtschreibung höher sein.
Was unternimmt die KMK, um das digitale Prüfen zu fördern?
Wir ermutigen Schulen und Lehrpersonen, damit zu experimentieren. Mit Pilotprojekten wollen wir herausfinden, was funktioniert und was nicht. Auf dieser Grundlage will die KMK mit Schulleitungen, Lehrpersonen und Technikverantwortlichen Standards für das digitale Prüfen definieren. Diese sind wichtig, damit die Qualität und die Vergleichbarkeit zwischen den Prüfungsorten gewährleistet ist. Im Fach Deutsch haben wir bereits einen solchen Standard. Die KMK erwartet, dass dieser angewandt wird.
Synthèse : Examens sur ordinateur au gymnase
Les gymnases bernois organisent de plus en plus souvent des examens sur ordinateur. Selon Michele Weber, président de la Commission cantonale de maturité (CCM), celle-ci salue cette évolution. Elle a aidé les gymnases à élaborer des normes communes, afin de garantir la qualité des examens et la comparabilité entre les lieux d’examen. Par ailleurs, le gymnase de Haute-Argovie joue un rôle précurseur en la matière : cette année, les examens de maturité en allemand, dans les langues étrangères et en informatique y seront réalisés sur ordinateur. Nicole Jakob (enseignante d’allemand) et Reto Zurbuchen (enseignant d’informatique) affirment que ce type d’examen est plus moderne et proche de la réalité. D’après eux, il est toutefois important que les élèves puissent s’y familiariser en cours d’année, notamment en ce qui concerne les aspects procéduraux et techniques.
Rolf Marti
Fotos: Rolf Marti
EDUCATION 2.24